|
I
Wie soll ich nur mit meiner Geschichte beginnen?
Auf die klassische Art und Weise?
Manchmal konnte mich mein Freund zur Verzweiflung bringen. So wie in diesem Augenblick, als er sich in dem Sessel niederließ, während der leblose Körper vor seinen Füßen lag. Er lehnte sich gemächlich zurück, zündete sich die verzierte Meerschaumpfeife an und schloss die Augen. Wie ich ihn kannte, dachte er jetzt an seine übelriechenden chemischen Experimente oder an seine geliebte Violine. »Schlaganfall!«, sagte er mit einem Male. »Bevor er zu Boden stürzte, lief er wie von Sinnen in kleinen Kreisen im Zimmer herum. Beachten Sie die Trittspuren auf dem Teppich! Sehen Sie, Doktor, die eine Gesichtshälfte ist ganz verzerrt. Kein Zweifel, ein Schlaganfall. Und in Unruhe versetzt hat ihn diese Nachricht!« Triumphierend hielt er ein Stück Papier in die Höhe. »Die Graphologie ist eine außerordentlich interessante Wissenschaft. Wir haben hier nun eine äußerst fahrige Handschrift, die trotzdem ihre Leserlichkeit bewahrt. Was besagt, dass der Verfasser ein gebildeter Mann in fortgeschrittenem Alter ist. Wenn auch – ungeachtet des weggelassenen i-Tüpfelchens – noch nicht ausgesprochen greisenhaft.« Er kicherte, als ich verdutzt von der Lektüre aufschaute. »Mir ist ganz unerfindlich«, sagte ich, »wie eine solche Nachricht jemandem Grauen eingeflößt haben soll. Sie mutet eher grotesk an.« »So scheint es. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass der Empfänger, ein kräftig gebauter Mann, davon umgeworfen wurde.« Ich deutete auf den Teppich: »Könnte nicht doch diese Metallspitze dort für seinen Tod verantwortlich sein …?«
Oder sollte ich vielmehr eine schnellere Gangart vorlegen?
Vor dem Gebäude knirschten die Bremsen mehrerer Fahrzeuge. Die Fondtüren flogen auf. Ein halbes Dutzend Burschen sprang heraus. Ihre Maschinenpistolen orgelten los und die Fensterscheiben der Pförtnerloge zersplitterten. Ich hechtete ins rettende Treppenhaus, riss dabei meinen .38er aus dem Schulterhalfter und feuerte. Ein Schrei bewies, dass ich getroffen hatte. Aber dann trieben sie mich mit einer Maschinenpistolengarbe die Treppe hinauf. Über, unter und neben mir pfiffen die Kugeln. Wohlerzogen klopfte ich an die nächstgelegene Bürotür und wartete. Ich klopfte noch einmal. Als sich immer noch nichts regte, nahm ich meinen .38er, trat zwei Schritte zurück und zerschoss das Schloss. Die Splitter flogen. Ich trat gegen die Tür und sie krachte auf. The Big Boss lag auf dem Boden. Seine Verletzungen erlaubten es ihm nicht, sich zu rühren. Ich drehte ihn vorsichtig auf den Rücken und er lächelte mich schwach an. »Gib' mir eine Zigarette«, sagte er. Ich entzündete eine Nil ohne Filter und steckte sie ihm zwischen die Lippen. »Prima«, hauchte er, »prima.« Er hustete. Dann verlor sein Gesicht den letzten Rest von Farbe und er sackte in sich zusammen. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. »Goodbye, alter Knabe!«, lachte ich grimmig und trat die Zigarette aus. Dann wechselte ich das Magazin des .38ers, drehte mich um und ging zur Tür. Es gab noch viel zu tun …
Vielleicht beginne ich doch lieber wie in einem Schauermärchen der Gebrüder Grimm. Oder wie Schehezerade in Tausend und einer Nacht den Sultan betört. Sie weiß, es wird ihren Kopf kosten, wenn ihr Vortrag keinen Gefallen findet.
Ja, das ist gut. Meine Geschichte könnte mit ›Es war einmal‹ beginnen.
Es war einmal …
Es war einmal eine kleine Maus …
Die kleine Maus saß mitten im kältesten Winter auf einer Wiese und fror vor sich hin. Vor der kleinen Maus stand eine große Kuh. Auf einmal machte es ›Flatsch‹ und der kleinen Maus wurde ganz warm ums kleine Herz. Just in diesem Augenblick kam ein Kater des Weges, sah die große Kuh und den großen Kuhfladen und aus dem großen Kuhfladen einen kleinen Mäuseschwanz hervorschauen. Der nimmersatte Kater zog am kleinen Mäuseschwanz, hielt die kleine Maus in die Höhe … und fraß sie auf.
Was lernen wir daraus?
Erstens: nicht jeder, der dich bescheißt, ist den Feind. Zweitens: nicht jeder, der dich aus der Scheiße zieht, ist dein Freund. Und drittens: wenn du schon in der Scheiße steckst, dann zieh den Schwanz ein. [1]
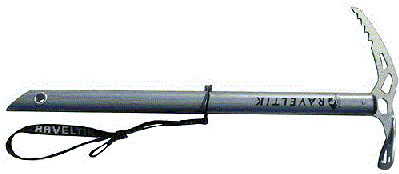
An diese Anekdote musste ich denken, vor allem an den letzten Teil, als ich Zwanziger vor mir auf dem Boden liegen sah. Tot, mausetot.
»Scheiße«, murmelte ich halblaut vor mich hin.
Der stämmige Körper Zwanzigers lag grotesk verrenkt vor der monumentalen Schrankwand seines Büros. Eine raffinierte Konstruktion mit einer versteckten Mini-Bar und einem Kühlschrank enthüllte sich meinen Augen. Bedauerlicherweise hatte ich keine Muße, den Inhalt anzutesten.
Eines war klar. Es war keine Herzattacke gewesen, die den Choleriker umgeworfen hatte. Auf dem dunkelgrünen Teppichboden konnte ich eine klebrige Masse aus Knochensplittern, Hirn, Blut und Haar erahnen. Zwanziger war erschlagen worden. Mit einem spitzen Gegenstand in die linke Schläfe knapp oberhalb des Ohres. Die Tatwaffe lag neben dem schweren Eichentisch, an dem schon Generationen von Administratoren und Konquistadoren über ihre wirtschaftlichen und politischen Imperien regiert hatten. Ein kleiner Stößel. Eine verkleinerte Nachbildung eines Eispickels, mit dem Reinhold Messner den Nanga Parpat bezwungen haben mochte. Eigentlich dazu gedacht, Eis zu zertrümmern und Getränke kühl zu halten. Er tat immer noch ganze Arbeit: Zwanziger war rapide dabei abzukühlen.
Der Mörder hatte die stählerne Spitze des Eispickels mit blinder Wut in Zwanzigers Hirn getrieben. Sein erstarrter Gesichtsausdruck zeigte aber eher Erstaunen als Angst. Die weit aufgerissenen Augen sahen kalt und ausdruckslos aus. Wie auf einer Fotografie aus dem neunzehnten Jahrhundert, während sie zu Lebzeiten kalt und stechend gewesen waren.
Ich muss gestehen, ich verspürte Mitleid. Ich bin einfach zu weich für solche Dinge. Aber Zwanziger war immerhin mein Boss gewesen. Wenn man denjenigen, für den man gelegentlich niedere Tätigkeiten verrichtet, Boss nennen kann. Eine permanente Beschäftigung hätte ich mir bei dem notorischen Nörgler jedenfalls nicht vorstellen können. Die plötzliche Gefühlsanwandlung kam zu einem guten Teil aber auch nur daher, dass Zwanziger mir meinen letzten Lohn schuldig geblieben war. Das war jedenfalls der Zweck meiner Stippvisite gewesen. In meinem Kopf machte ich mir nun die Notiz, in der nächsten Woche Zwanzigers Vorgesetzten anzuklingeln. Oder sagt man jetzt: Zwanzigers Ex-Vorgesetzten?
Hier im Verwaltungsgebäude war außer mir keine lebende Seele mehr anwesend. Es war Ferienzeit. In den Fertigungshallen war nur eine Tagschicht an der Arbeit und die saß längst zuhause mit der Bierflasche vor dem Fernsehgerät. Ich wandte mich auf leisen Sohlen zum Gehen. Schließlich ging mich die ganze Sache nichts an und ich verspürte wenig Lust, mit einem Vertreter des Gesetzes komplexe Sachverhalte zu erörtern. Da sah ich etwas Helles in der rechten Hand des Hingemeuchelten. Ein Stück Papier.
Die Katze lässt das Mausen nicht.
Ich zog vorsichtig an Zwanzigers Jackettärmel, hob die leblose Hand an und befreite einen kleinen Zettel aus den fleischigen Fingern. Es war ein Notizblockblatt in DIN A6-Format. Hellrosa kariertes Papier, dunkelrote Firmenwerbung: ›Da fahren Sie drauf ab!‹ Mit einem Kugelschreiber hatte jemand mit zittriger Hand vier knappe Zeilen in den Karos festgehalten. Stirnrunzelnd las ich:
Die Herren Zwanziger die Henker sind,
Die Diener ihre Schergen,
Davon ein jeder tapfer schindt,
Anstatt was zu verbergen.
Krude Reime. Goethe war nicht der Killer, soviel war sicher. Wenn der Täter mit dem Verfasser dieser Zeilen identisch war.
Ich las den Vers noch einmal durch. Ein drittes Mal. Aber keine Offenbarung überkam mich. Zwanziger selbst hatte das Gedicht sicherlich nicht geschrieben. Er war kein Schöngeist gewesen. Seine kulturellen Ambitionen beschränkten sich darauf, gelangweilt im Theater oder im Konzertsaal herumzusitzen. Darauf wartend, im Anschluss in eine Nachtbar mit Oben-Ohne-Bedienung und Table-Dance aufzubrechen. Ich konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass Zwanziger bei seinen geschäftlichen Angelegenheiten in irgendeiner Form gezweifelt hätte. Selbst wenn er der Verwaltungschef des Archipels Gulag gewesen wäre. Etwas in der Art schien der Vierzeiler anzudeuten: Zwanziger der Henker. Seine Schergen. Zu denen ich ja dann auch irgendwie gehörte.
»Scheiße«, murmelte ich noch einmal.
Mir lief es heiß und kalt zugleich den Rücken hinunter. Ich beschloss spontan, den Schwanz einzuziehen und das Weite zu suchen.
II
In der Nacht hatte ich einen feuchten Traum.
Es regnet im deutschen Wald. Ich folge der blond-bezopften Oberförsterstochter, als sie beschwingt wie eine Nymphe durch die Büsche springt. Sie beobachtet die Kohlmeisen und lässt flache Kieselsteine über die Wasseroberfläche des Teiches hüpfen. Ich stolpere und rutsche ihr hinterher, während sie einen glitschigen Pfad entlang eilt. Sie ist zum Greifen nahe, doch ich vermag ihr nicht nahe zu treten. Ich renne, falle, fluche, hetze weiter. Tiefer und tiefer in den Wald. Ich steige über vermoderte Baumstümpfe und verschlungene Wurzeln, wate durch Wasserlöcher, stoße mich an kantigen Felsen. Spitze Dornen stechen in meine Haut, während ich mir einen Weg durch das Unterholz bahne. Der Regen fällt ohne Pause. Endlich. Auf einer Waldeslichtung hält sie ein in ihrem Spiel. Als ich sie außer Atem eingeholt habe, sehe ich den Grund. Im Gras ausgestreckt liegt Zwanziger. In einem mir bereits bekannten Aggregatzustand. Ich sehe verstört in die waldmeistergrünen Augen der Oberförsterstochter und sage mit ernster Miene …
»Du blöde Fotze du!«
Was?
Ich wurde unvermittelt aus dem Schlaf gerissen. Es war beinahe Mittag und im Stockwerk unter mir ging es hoch her. Bumm, bumm, bumm. Jemand trat kräftig gegen eine Wohnungstür und eine Männerstimme brüllte wie ein wild gewordener Gorilla.
»Mach auf, Alte ey. Ich lass mich doch nicht verarschen.«
Das Gebrüll musste bis zur Stadtgrenze zu hören sein.
»Ich trink dein Blut, du Schlampe. Ich spül dich im Klo runter, Mann.«
Eine Frauenstimme keifte etwas Unverständliches zurück. Nicht mein Bier, sagte ich mir und drehte mich auf die andere Seite. Manchmal bin ich es doch leid, dass sich in der Etage unter mir ein Schwarm Bordstein-schwalben eingenistet hat. Andererseits hat das natürlich auch Vorteile.
Bevor ich mich noch einmal um die Oberförsterstochter kümmern konnte, klingelte das Telefon. Ich ließ es läuten, aber der Anrufer war beharrlich. Scotty, beamen!
»Hier Brücke«, brummte ich in den Hörer.
»Guten Morgen«, vernahm ich eine weibliche Stimme. »Hier spricht Danowski, Abteilung F der Automotronix AG …«
»Aye, aye«, unterbrach ich, bevor mir die gute Frau ihre ganze Lebensgeschichte offenbaren würde. »Käpt’n Kirk ist austreten. Hier ist der mit den spitzen Ohren.«
Sie ließ sich nicht beirren. »Ich bin beauftragt, Sie zu fragen, ob es Ihnen genehm wäre, heute Vormittag bei Dr. Van Aken vorstellig zu werden.«
»Ich müsste mal in meinen Terminkalender schauen. Ich …«
»Vielen Dank. In einer Stunde. Sie kennen, denke ich, den Weg.«
Klick. Und ich hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, den Bordcomputer anzuwerfen.
Ich stand auf, wusch mir den schlaftrunkenen Ausdruck aus dem Gesicht und stieg die acht Stockwerke ins Erdgeschoss hinunter. Eine falsche Blondine knallte gerade eine Wohnungstür zu. Der Gorilla versperrte den Gang und ich wünschte mir, dass ich nicht immer den Fahrstuhl meiden würde. Der Vergleich mit einem Menschenaffen war nicht schlecht gewählt. Sein buntes Hawaiihemd hatte er bis zum Bauchnabel aufgeknüpft. Er plusterte den Brustkasten auf, so dass seine Arme durch die Rückenmuskeln vom Körper weggespreizt wurden und ins Pendeln gerieten.
Angriff ist die beste Verteidigung, dachte ich, als er zu einer weiteren Aneinanderreihung wüster Beschimpfungen ansetzte. Ich fuhr meine stärkste Waffe auf: Ironie!
»Na, wie sieht’s aus? Im Großstadtdschungel verlaufen und das Empire State Building nicht gefunden?«
Der Gorilla sprach kein Wort. Er bleckte mich angriffslustig mit schlechten Zähnen an. Sein Atem roch nach Alkohol.
»Wenn man wie ein wildes Tier im Käfig herumläuft, befindet man sich normalerweise im Käfig«, sagte ich. »In freier Wildbahn darf man ruhig den Gang freimachen, die Treppe hinabsteigen und durch die Tür das Haus verlassen. Ich betone das Wort ruhig.«
Es war ein ungleicher Kampf. Er starrte mich verständnislos an. Dann griff er in den Schritt, rückte sein Gehänge zurecht und machte Platz. Als ich an ihm vorbeiging, zogen sich seine Gesichtsmuskeln zusammen und Falten bildeten sich um seine Augen. Der Mund öffnete sich, so dass ich wieder das lückenhafte Gebiss sah. Bei Humanoiden nennt man das wohl ein freundliches Lächeln.
![Die Wohnung liegt mitten in der City und ich überblicke von hier oben den gesamten Kiez. Kein Palast, aber auch nicht Onkel Toms Hütte. [Photo by Tom Keller]](p/blg02.jpg)
Kurioserweise treibt es mich immer wieder in luftige Höhen, obwohl ich gar nicht schwindelfrei bin. Meine derzeitige Heimat habe ich auf dem Dach des besagten Gebäudes gefunden. Ein Pickel auf dem Flachdach, in dem einmal die gesamte Haustechnik untergebracht war. Mit dem großen Wasserspeicher lebe ich immer noch Wand an Wand. Penthouse hatte mein Vermieter damals großspurig inseriert. Wahrscheinlich mit Blick auf die illustre Nachbarschaft. Aber die Wohnung liegt mitten in der City und ich überblicke von hier oben den gesamten Kiez. Sie ist preiswert und ein erheblicher Fortschritt zu meiner winzigen Studentenbude.
Kein Palast, aber auch nicht Onkel Toms Hütte.
Das Apartment besteht aus einem einzigen großen Zimmer. Mit einer Regalwand hatte ich Schlafcouch und Küchenzeile getrennt und damit einen gemütlichen Lebensraum geschaffen. Der bietet genügend Platz für eine mittelgroße Sammlung an Vinylschallplatten, CDs und Musikinstrumenten, sowie die von Großväterchen geerbte Standuhr und ein 360-Liter-Salzwasseraquarium. Wenn ich jetzt noch die Kachelabteilung mitzähle, dann ist mein Reich wie das keltische Gallien in drei Teile geteilt. Eine von einem unbeugsamen Krieger bevölkerte Festung, die nicht aufhört, unerwünschten Eindringlingen Widerstand zu leisten. Nur äußerst selten verirren sich Zeugen Jehovas oder Eintreiber von der Gebühreneinzugszentrale auf das Dach hinauf, um meine unsterbliche Seele retten zu wollen.
Wie auch immer. Mir gefiel’s.
Ich zog die Morgenzeitung aus dem Briefkasten. Genauer gesagt, aus dem Briefkasten einer meiner Untermieterinnen, die seltsamerweise die Zeitung zugestellt bekam, aber mangels Sprachkenntnissen nicht las. Der Gorilla war verschwunden, als ich wieder himmelwärts stieg. Er hatte entweder Einlass gefunden oder kletterte an der Fassade herum. Mir konnte es wurscht sein.
Beim Frühstück unter dem aufgehängten Puzzle von Velázquez’ ›Venus und Cupido‹ überflog ich die Schlagzeilen: Bush Wars Episode 3, die neuesten Tollheiten aus dem Parlament, der Papst und andere Popstars. Von den Wirtschaftsnachrichten will ich lieber schweigen. Anstatt mir das tägliche Katastrophenmenü einzuverleiben, sollte ich lieber jeden Morgen ein Gedicht lesen, ein Lied komponieren oder ein Kind zeugen. Es wäre sicher ein Gewinn.
Der tote Zwanziger wurde im Lokalteil abgehakt. Die Redaktion meldete knapp, dass Zwanziger – unmittelbar nach meinem Abgang von der Szene – von einem Wachmann aufgefunden worden war. Den vorläufigen gerichtsmedizinischen Erkenntnissen zufolge war er am späten Nachmittag mit einem spitzen Gegenstand erschlagen worden. Die ermittelnde Hauptkommissarin Schultze-Döneken erklärte, dass weder wirtschaftliche noch persönliche Tatmotive ausgeschlossen werden konnten.
Ein Foto aus seinen Lebtagen zeigte Zwanziger feist hinter dem Schreibtisch thronen. Er blickte unter buschigen Augenbrauen entschlossen in die Kamera, das Kinn angriffslustig emporgereckt. Zwanziger trug einen maßgeschneiderten, hellen Seidenanzug und eine bizarre Seidenkrawatte, auf der Dagobert Duck in einer Badewanne mit Goldstücken badete. Wenn das nicht bezeichnend ist, dann weiß ich auch nicht.
Sein Lebenslauf folgte. Was ich nicht gewusst hatte, war, dass Zwanziger graduierter Diplom-Betriebswirt gewesen war und er eine Frau und einen Sohn hinterließ. Seit mehreren Jahren war er bei der Automotronix AG beschäftigt gewesen, unter anderem als Werkleiter in Tschechien und Südafrika. Vor zehn Monaten war er als stellvertretender Leiter der Abteilung F in das Stammwerk zurückgekehrt. Ansonsten brachte die Meldung kaum Neuigkeiten für mich. Ich wusste sogar mehr als die Zeitungsfritzen und offenbar auch die Polizei, denn von dem merkwürdigen Reim war überhaupt nichts vermeldet.
Das wunderte mich dann allerdings gar nicht mehr, als ich in meine Jacke schlüpfte und in der Seitentasche ein Stück Papier fand. Ein Notizblockzettel, Format DIN A6, hellrosa kariert …
III
Und so begab ich mich zum zweiten Mal in dieser Woche zur Automotronix AG vor die Tore der City.
Den Motorroller, den ich Areion getauft hatte, hatte ich unlängst bei einem Gewinnspiel gewonnen, als ich die Frage ›Wer kämpfte im Kolosseum?‹ nicht mit ›Moderatoren‹ beantwortet hatte. [2] Um mich in meinem Kiez fortzubewegen, benötige ich kein motorisiertes Fortbewegungsmittel. Will ich aber in die nähere Umgebung, so ist ein solches mehr als angebracht.
Unsere Großsiedlung zwischen Harz und Heide liegt im geographischen Mittelpunkt der Republik. Nun, nicht exakt, aber nur unwesentlich daneben gerückt. Schon die alten Neandertaler hatten in den feuchten Niederungen Rentiere und Mammuts gejagt. Die Cherusker schmiedeten Schwerter und Speere aus dem heimischen Erz, um den Einzug römischer Zivilisation in Germanien zu verhindern. [3] Dann passierte zweitausend Jahre lang nicht besonders viel. Gelegentlich zog ein Heer vorbei und brandschatzte und plünderte eines der Dörfer. Ansonsten bestellten die Leute ihre Felder, jagten ihre Schafe über die Wiesen, frönten dem Hanf, der noch meterhoch am Wegesrand blühte, und ließen den lieben Gott einen guten Mann sein.
Die braunen Horden veränderten die ländliche Idylle für alle Zeit. Der Reichsmarschall warf seinen Hirschfänger auf die Landkarte und stampfte ein Stahlwerk aus der Scholle. Es solle das größte Hüttenwerk werden, das die Welt kenne. Und die zugehörige Siedlung eine Millionenstadt in Form eines Hakenkreuzes. So weit die Legende, so weit die Theorie. Aber tausend Jahre waren nicht genug. Von sechsunddreißig geplanten Hochöfen gingen nie mehr als zehn in Betrieb. Theater, Volkshalle und Universität, die breiten Aufmarschstraßen und die gigantischen Plätze wurden nie gebaut. Die Siedlung blieb eine Präriestadt, in der Bergleute und Hüttenarbeiter, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, Flüchtlinge, Vertriebene und Aussiedler hängen blieben. Die Mischpoke, mit der wir es nun – zum Verdruss aller deutschnationalen Raben – zu tun haben.

Die knapp fünf Kilometer zur Automotronix AG hatte ich in weniger als einer Viertelstunde zurückgelegt. Ich stellte den Motorroller ab, betrat das mehrstöckige Verwaltungsgebäude und stieg in das oberste Geschoss. ›Dr. A.C. Van Aken‹ stand auf dem Türschild des Büros. Im Gegensatz zu den anderen Türschildern in der Abteilung F glänzte das Messing noch jungfräulich. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Zwanziger den Namen jemals erwähnt hatte.
Die Büros von Zwanziger und Van Aken lagen direkt nebeneinander, nur getrennt von dem Sekretariat. Allerdings war mir auch die Chefsekretärin bislang noch nie leibhaftig begegnet, da ich Zwanziger immer erst nach Dienstschluss aufgesucht hatte. Ich klopfte und trat ein. Die Vorzimmerdame hatte ein schmales Gesicht und eine spitze Nase. Ihr getöntes Haar hatte sie auf dem Hinterkopf zu einem Dutt gesteckt. Als sie sich in ihrem Drehstuhl aufrichtete, klimperte eine Holzperlenkette über ihrem wogenden Busen.
»Hallo«, grüßte ich und stellte mich vor. »Wir haben miteinander telefoniert. Ihr Chef, Herr Van Aken, verlangt nach meiner Wenigkeit.«
»Verzeihen Sie. Frau Van Aken, meinen Sie sicherlich.« Die Dame lächelte freundlich, soweit ich das hinter dem Make-up erkennen konnte.
»Frau Van … Ah, sicher. Meine ich, Frau Danowski.«
»Fräulein, bitte!«
»Fräulein Danowski. Gerne auch.«
Sie meldete mich über die Gegensprechanlage an und ich betrat mit rotem Kopf die Räumlichkeiten von Herrn – pardon, ich meine – Frau Van Aken. Zwanzigers direkte Vorgesetzte und Leiterin der Abteilung F. Ich befand mich nun im Zentrum des Automotronix-Werkes. Wie nicht nur die Aktionäre der Automotronix AG wissen, manchmal bejubeln und manchmal beklagen, handelt es sich bei dem weltweit tätigen Unternehmen um einen der wichtigsten Elektronikzulieferer der Automobilindustrie.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Mein Herz tat einen kleinen Sprung. Frau Van Aken stand auf und begrüßte mich mit einem festen Händedruck. Zwanziger ließ unsereinen einfach stehen, während er Honoratioren Zigaretten aus einem Silberetui angeboten hatte. Ein Familienerbstück, hatte er einmal behauptet, mit einem gekrönten Adler eingraviert auf der Vorderseite. Ich ließ mich auf einem Bürosessel aus Chrom und Leder nieder.
»Darf ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten? Sie sehen ja ganz erhitzt aus.«
Diese Frage hatte ich nicht als erstes erwartet. »Wasser? Ah ja, gerne.«
Frau Van Aken bediente einen gläsernen Wasserspender und einen Augenblick später hatte ich einen gefüllten Becher in der Hand. Die Luftblasen gluckerten, während sie mich einzuschätzen versuchte. Und ich sie.
Im Gegensatz zu Zwanzigers feudaler Inneneinrichtung war ihr Büro sparsam möbliert und funktional eingerichtet. Leichte Designermöbel, helle Farben, Grünpflanzen in Keramiktöpfen. Der Schreibtisch war pikobello aufgeräumt, eine Tageszeitung sorgfältig zusammengefaltet. Es fehlte jegliche persönliche Note, insbesondere das typische Familienbild mit Göttergatten und Kindersegen.
Frau Van Aken selbst war eine aparte Erscheinung. Ein offenes Gesicht, kurze, pechschwarze Haare. Ihre Augen waren von einem dunklen Blau, fast so schwarz wie ihre Haare. Sie war eigentlich zu jung für den Abteilungsleiterposten, aber vielleicht hatte jemand Starthilfe gegeben. Bei so einem Namen.
Ich nahm einen Schluck Wasser und ließ das kühle Nass die Kehle herunter rinnen. Sie schaute mich mit durchdringendem Blick an. »Sie sind also der Laufbursche von Herrn Zwanziger? Ich muss sagen, dass ich Sie mir ganz anders vorgestellt habe.«
»Ich nehme das als ein Kompliment.«
»Sie wissen sicherlich, warum ich Sie hergebeten habe. Sie haben die Zeitung gelesen?«
Ich nickte. Wenn die wüsste.
»Haben Sie eine Ahnung …?« Sie biss sich auf die Lippen. »Ich meine, die Polizei … Das Unternehmen … Wir wissen nicht, warum jemand Herrn Zwanziger nach dem Leben getrachtet hat.«
Mir wäre da schon einiges eingefallen. »Tut mir Leid, ich kannte Zwanziger nicht persönlich.«
»Natürlich nicht. Sie haben für Herrn Zwanziger gearbeitet?«
»Was heißt gearbeitet. Ich würde sagen, hie und da ein paar Dinge gemeistert, die außer Haus erledigt werden mussten.«
»Außer Haus? Das bedeutet, zum Beispiel?«
»Nun …«
Was hatte ich für Zwanziger und Automotronix gemeistert? Meistens Postbote oder Chauffeur gespielt. Ich hatte für die feinen Herren Geschäftsessen organisiert – inklusive weiblichem, gegebenenfalls männlichem Begleitservice. Ich hatte an wissenschaftlichen Experimenten mitgewirkt – mit bewusstseinserweiternden natürlichen Pflanzenstoffen und synthetischen Substanzen gleichermaßen. Einmal durfte ich sogar einen Geldtransport durchführen – das Geld befand sich in einem unauffälligen, braunen Umschlag.
Alles in allem also eine sehr vielseitige und interessante Tätigkeit, von der ich Frau Van Aken allerdings nur einen Bruchteil erzählen mochte.
Sie nickte, registrierte ich erleichtert, nachdem ich ihr eine entschärfte Version dargeboten hatte. »Und davon können Sie leben?«
»Wie sagt man so schön: zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. An guten Tagen habe ich sogar noch die Kraft, auf Gottes Schöpfung und die Schlechtigkeit in der Welt zu schimpfen.«
»Also gut.« Sie schnitt mir das Wort ab, nicht an meiner Litanei interessiert. »Seien Sie versichert, dass wir auch in Zukunft Ihre Dienste in Anspruch nehmen werden. Sie bekommen von nun an Ihre Aufträge direkt von mir. Wer auch immer der Nachfolger von Herrn Zwanziger werden wird.«
Falls das eine Drohung gewesen sein sollte, war mir das gar nicht so unangenehm.
Sie sah mich an. »Oder haben Sie damit ein Problem?«
»Was meinen Sie?«
»Für eine Frau zu arbeiten.«
»Kein Problem. Ich arbeite auch für das weibliche Geschlecht. Gelegentlich.«
»Aha. Und was tun Sie … so gelegentlich … für das weibliche Geschlecht?«
»Nun ja. Alles, wofür sie mich bezahlen.« Ich beließ es dabei, peinlich berührt.
Frau Van Aken erhob sich. Die Audienz war beendet. Zum ersten Mal lächelte sie. »Ich glaube, Sie sind gar nicht so unsympathisch, wie Sie sich den Anschein geben. Kann das sein?«
Was sollte ich dazu sagen? »Kann sein«, nuschelte ich.
IV
Das Wochenende ist mir heilig. Schließlich renne ich von Montag bis Freitag Aufträgen und Jobs jedwelcher Art hinterher. Gelegentlich zupfe ich in einer Amateurjazzband den Bass. Ansonsten verbringe ich das Wochenende mit entspannenden Beschäftigungen. Ich mache es mir gemütlich. So gesehen bin ich ein typischer Deutscher und stolz darauf.
Die City, die sich wie eine ovale Insel vom Rathaus zum Bahnhof erstreckt, liegt zwischen der lockeren Haufendorfstruktur des alten Dorfkerns und den langen Wohnzeilen der Nachkriegszeit. Eine Stadt wie Tausend andere, entworfen von einem lustlosen Architekten. Die Fußgängerzone unterscheidet sich in nichts von der Fußgängerzone in Flensburg oder in Rosenheim. Ein nicht unbedeutender Teil der Verkaufsfläche steht leer. Die übrig gebliebenen Geschäfte bieten vor allem billige Ramschware an.
Ich verlasse selten meine kleine Gemeinde, die platzartige Erweiterung der Hauptstraße am Fuße meiner Dachlaube. Mir bietet das quadratkilometergroße Areal jedenfalls alles Nötige, um den täglichen Lebensbedarf befriedigen und Leib und Seele zusammenhalten zu können. In einem Vorbau meines Hauses hat sich die WunderBar eingenistet, wovon ich Ihnen später noch Näheres berichten werde. Ich brauche nur die dort beginnende Fußgängerzone zu queren, um mich im Tabak-Kontor gegenüber erlesenen Genüssen erfreuen zu können. Dabei interessieren mich die exotischen Glimmstengel überhaupt nicht. Umso mehr aber die exquisite Auswahl an edlen, hochprozentigen Getränken, die ein findiger Geschäftsmann ins Sortiment aufgenommen hat. Gleich daneben befindet sich Alis libanesische Imbissbude, in dem besagter Ali mit Frau und Kind die Fladenbrote füllt. Überquere ich nun die Hauptstraße und setze den Rundgang um den Platz im Uhrzeigersinn fort, dann kann ich im Gastgarten des Wursthauses ebenfalls fleischigen Gelüsten frönen. Noch ein paar Geschäfte und ich kehre wieder in der WunderBar ein.
Sie ahnen sicherlich schon aus dieser etwas sentimentalen Schilderung, dass das kommende Wochenende ganz und gar nichts Heiliges an sich haben würde.
»Wird langsam gewalttätig, unser kleines Städtchen«, dachte ich laut in Richtung Aquarium, als ich in der Freitagszeitung die wöchentliche Polizeibilanz überflog.
![Wolfgang Meyering: »Erstens: nicht jeder, der dich bescheißt, ist den Feind. Zweitens: nicht jeder, der dich aus der Scheiße zieht, ist dein Freund. Und drittens: wenn du schon in der Scheiße steckst, dann zieh den Schwanz ein.« [Photo by Tom Keller]](../31/p/malbrook.jpg) Fußnoten:
Fußnoten:
[1] Vielen Dank an Wolfgang Meyering für die Geschichte von der kleinen Maus. Er erzählte sie bei Konzerten mit seiner Gruppe Malbrook (s. rechts, FW#29). Wolfgang hatte allerdings einen kleinen Vogel – in seiner Geschichte.
[2] In Wirklichkeit habe ich nicht bei diesem Fernsehsender angerufen, weil mir die Antwort Moderatoren auf die Frage Wer kämpfte im Kolosseum? zu blöd war. Es gab eh keinen Roller zu gewinnen.
[3] Vor etwa zwei bis drei Jahrzehnten lautete die Werbung der Hüttenwerke Peine-Salzgitter tatsächlich: Schon Hermann schlug im Wesertal, die Römer mit Salzgitterstahl.
|
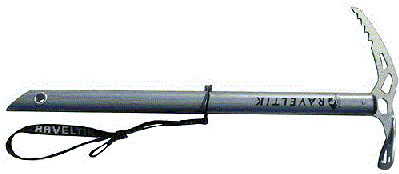
![Die Wohnung liegt mitten in der City und ich überblicke von hier oben den gesamten Kiez. Kein Palast, aber auch nicht Onkel Toms Hütte. [Photo by Tom Keller]](p/blg02.jpg)

![Wolfgang Meyering: »Erstens: nicht jeder, der dich bescheißt, ist den Feind. Zweitens: nicht jeder, der dich aus der Scheiße zieht, ist dein Freund. Und drittens: wenn du schon in der Scheiße steckst, dann zieh den Schwanz ein.« [Photo by Tom Keller]](../31/p/malbrook.jpg) Fußnoten:
Fußnoten: